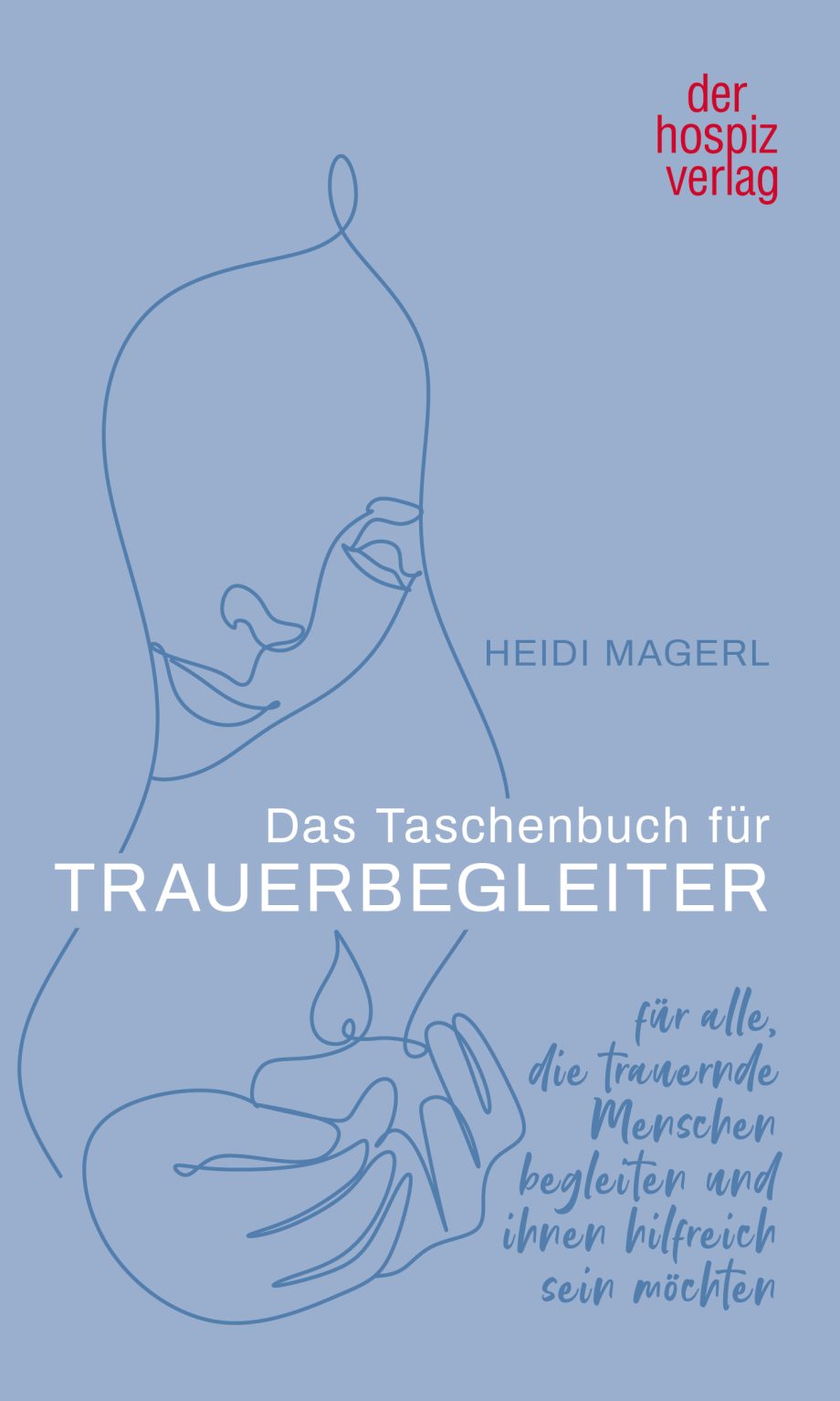Palliative Kompetenz im stationären Altenheim erfolgreich ausgebaut
Am 17. Und 19. März 2025 fanden sich die Beteiligten zweier Modellprojekte zur Palliative Care im Wohnpark St. Martinus in Blitzenreute und zum Wohnpark am Rotbach in Mittelbiberach im Allgäu zusammen.
Vor zwei Jahren, im April 2023 hatten die Beteiligten des Modellprojekts „Palliativ Care im Wohnpark St. Martinus in Blitzenreute“ sich die Zielsetzung gegeben, die palliativen Kompetenzen in der stationären Altenhilfe weiterzuentwickeln, zu stärken und gezielt umzusetzen. Mit dem Modellprojekt wollten sie die palliativ-geriatrische Versorgung der Bewohner weiter verbessern, damit sie am Ende ihres Lebens die größtmögliche, individuelle Lebensqualität erfahren können.
Teil des Projekts war die Grundannahme, dass bei einem höheren Personalschlüssel und einer zuständigen, verantwortlichen Palliative-Care-Fachkraft die Qualität der palliativen Versorgung in der Altenpflege spürbar erhöht werden kann.
Dabei ist zu erwähnen, dass aus medizinischer Sicht nicht jeder Bewohner einer stationären Altenhilfeeinrichtung ein Palliativpatient ist.
Aber jeder Bewohner und Bewohnerin, der sich in seiner letzten Lebensphase befindet oder sterbend ist, soll grundsätzlich aus einer palliativen Grundhaltung heraus versorgt werden. Auf dieser Basis wurde das „Modellprojekt Palliative Care“ entwickelt, dass am 1. April 2023 unter der Projektleitung von Conny Frick startete.
Das Projekt wurde mit 200.000 Euro seitens der Hospizstiftung Biberach gefördert, zwei neu eingestellte Palliative Care Fachkräften unterstützten in der Praxis. Die Projektlaufzeit wurde auf zwei Jahre ausgelegt.
Bei Netzwerktreffen am 17. Und 19. März für beide Projekte zogen Verantwortliche und Beteiligte ein positives Zwischenfazit zum Modellprojekt „Palliative Care“.

Susanne Sieghart, Geschäftsbereichsleiterin Altenhilfe und Hospize (1. Reihe, 3.v.l.), Projektleiterin Cornelia Frick (1.Reihe 2.v.l.), Claudia Ziegler, Wohnparkleiterin St. Martinus Blitzenreute (2. Reihe, 2.v.l.), Palliativfachkraft Irmlind Illing-Graf (1. Reihe, 6.v.l.) und Palliativfachkraft Barbara Hehl (1. Reihe 4.v.l.). (Bild: Stefanie Keppeler/St. Elisabeth-Stiftung)
Mehr Sicherheit, weniger Krankenhauseinweisungen
Wohnparkleiterin Claudia Ziegler zeigte sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf: „Wir können auf zwei lehrreiche Jahre zurückblicken.“ Auch wenn die finalen Auswertungsdaten noch ausstehen, berichten die Beteiligten bereits jetzt von spürbaren Verbesserungen im Alltag. Besonders häufig genannt wurden:
• eine verbesserte Kommunikation zwischen allen Beteiligten
• eine sensiblere und aussagekräftigere Dokumentation
• ein gestärktes Selbstbewusstsein der Mitarbeitenden im palliativen Kontext
• eine deutlich geringere Zahl an Krankenhauseinweisungen
Kommunikation als Schlüssel zur besseren Versorgung
Pflegedienstleiterin Amelie Slavik betonte die zentrale Rolle der Kommunikation: „Eine gute Kommunikation zwischen allen Schnittstellen, Verantwortlichen und Mitarbeitenden ist von großer Bedeutung.“ Auch im Umgang mit Hausärztinnen und Hausärzten sei eine neue Sicherheit spürbar.
Irmlind Illing-Graf, Palliative-Care-Fachkraft mit einer halben Stelle im Wohnpark St. Martinus, hob besonders die Qualitätsverbesserung bei der Dokumentation hervor. Sie werde heute deutlich feinfühliger geführt – etwa durch Hinweise auf die Reaktion von Bewohnerinnen und Bewohnern auf Pflegeangebote, was in der letzten Lebensphase besonders wertvoll sei.
Wünsche der Bewohner im Fokus
Ein weiterer Effekt: Die Zahl der Krankenhauseinweisungen in palliativen Situationen habe sich reduziert. „Früher wurden Bewohner häufiger ins Krankenhaus gebracht. Heute gelingt es uns öfter, sie bei uns im Wohnpark zu begleiten – in enger Abstimmung mit den Hausärzten“, so Claudia Ziegler. Für viele Bewohner sei es wichtig, in vertrauter Umgebung sterben zu können.
Perspektive: Palliative Versorgung braucht nachhaltige Finanzierung
Susanne Sieghart, Geschäftsbereichsleiterin Altenhilfe und Hospize der St. Elisabeth-Stiftung, zeigte sich dankbar für die Förderung durch die Hospizstiftung Biberach, bedauerte aber das Fehlen einer Anschluss- oder Regelfinanzierung. Rund 220.000 Euro seien bislang in das Projekt geflossen.
„Wir werden unser Angebot weiterentwickeln – auch wenn nicht in der gleichen personellen Intensität wie während der Projektphase. Zusammen mit der größten Krankenkasse wollen wir den Mehrbedarf sichtbar machen, denn palliative Versorgung ist mit dem aktuellen Personalschlüssel nicht leistbar“, so Sieghart.
Die Evaluationsergebnisse werden voraussichtlich belegen, dass durch eine qualifizierte palliative Versorgung Krankenhauseinweisungen vermieden werden können.
Zum Weiterlesen