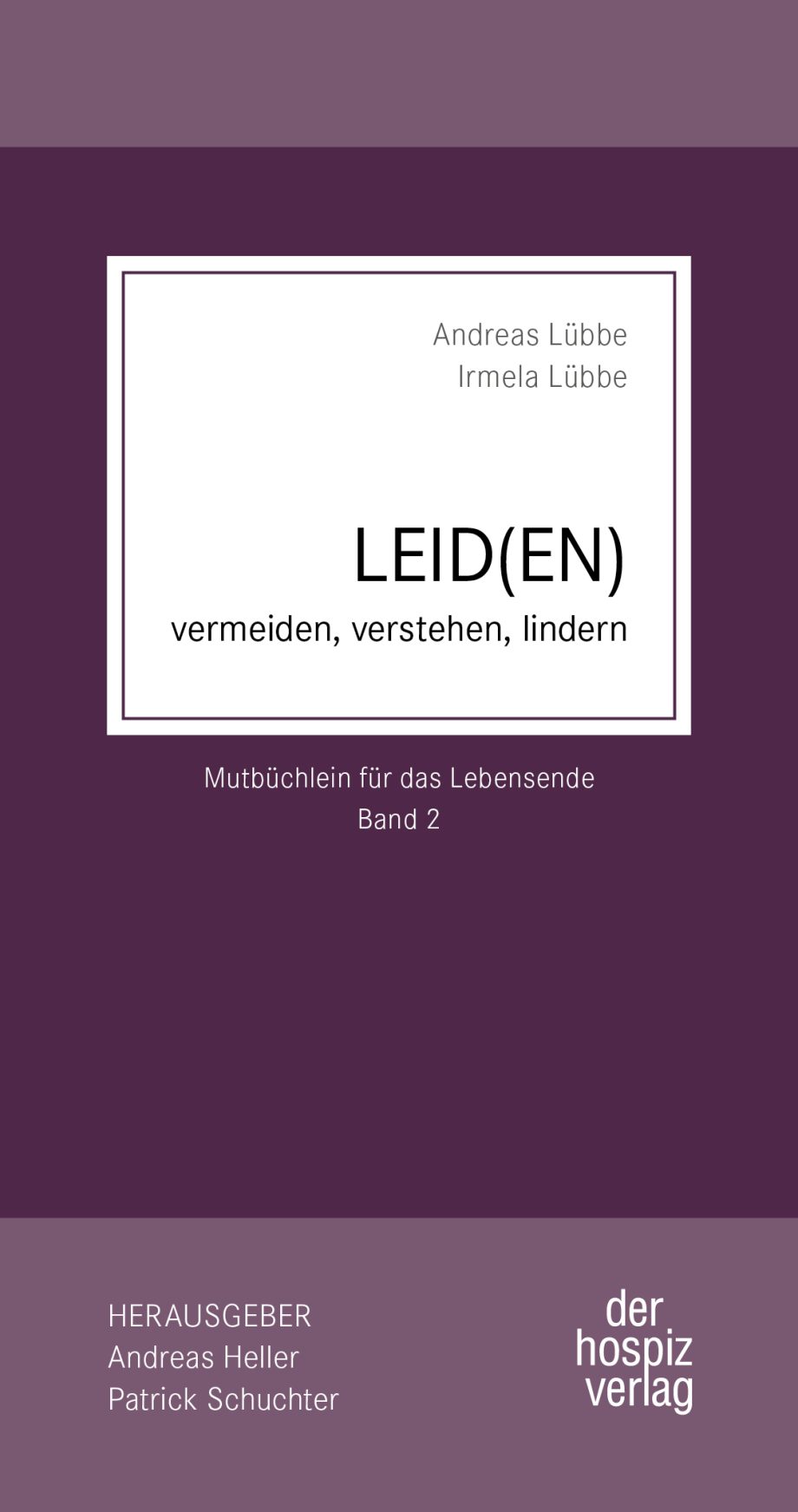Neuerscheinung
Leid(en), ein Mutbüchlein
„Leid(en)“ ist nicht nur ein Buch, das Antworten gibt – es lädt zum Denken, Fühlen und Mitfühlen ein.
Wir haben mit den AutorInnen, Prof. Lübbe und Frau Dr. Lübbe über Mut, Menschlichkeit und die Kunst des Leid(ens) gesprochen.
Wie ist die Idee zu „Leid(en)“ entstanden – und was hat Sie persönlich dazu bewegt, sich diesem Thema zu widmen?
Meine Frau und ich haben jahrzehntelang Menschen an ihrem Lebensende betreut; sie als Psychologin, ich als Arzt. Wir haben festgestellt, dass Mensch-Sein weit mehr umfasst als die Freiheit von Beschwerden. Viele litten trotz guter Schmerztherapie. Mit diesem Buch wollen wir einen Perspektivwechsel vorstellen, das Leiden selbst in den Blick nehmen und Helfenden Möglichkeiten aufzeigen, Leiden zu erkennen und ihm zu begegnen. Dazu gehören Mut und die Fähigkeit, eine bestimmte Haltung einzunehmen und aus anderer Perspektive auf die leidende Person zuzugehen. So entstand dieses „Mutbüchlein“.
Der Titel „Leid(en)“ spielt mit einem Wort, das zugleich Schmerz und Tun beinhaltet. Was bedeutet dieser Doppelsinn für Sie?
Die Doppeldeutigkeit ist gewollt. Früher bezeichnete man Krankheiten als „Leiden“, wie etwa das Magenleiden. „Leid“ als abstrakter Begriff greift für unsere Zwecke zu kurz. „Leiden“ weist auf den dynamischen Prozess hin: man leidet und erträgt sein Schicksal eine Zeit lang. Würde man nur vom „Leid“ sprechen, ginge dieser Aspekt verloren. Wir verstehen unter „Leid(en)“ das Aushalten-Müssen von etwas Unangenehmem – körperlichen, seelischen oder existenziellen Beschwerden, aber auch Einschränkungen in der Lebensgestaltung.
Sie schreiben vom Mut, sich mit dem eigenen Lebensende auseinanderzusetzen. Warum ist dieser Mut heute so wichtig – auch für professionell Begleitende?
Noch zu unserer Großelterngeneration war der Tod alltäglich: Alte Menschen lebten und starben im Familienkreis, Kindersterblichkeit war höher, und der Tod war durch Glauben, Kirchenbesuche und Rituale präsent. Zugleich gaben Frömmigkeit und Hoffnung Halt. Die beiden Weltkriege machten den Tod ohnehin allgegenwärtig.
Heute hingegen halten wir den Tod auf Distanz und konsumieren ihn aus sicherer Entfernung über Medien. Familiäre und soziale Bande sind schwächer, religiöser Halt ist selten, Selbstoptimierung dominiert. Darum braucht es Mut, sich dem eigenen, einzigartigen Ende zuzuwenden. Wer dies tut, gewinnt Freiheit, den Weg und das Ende bewusst zu gestalten und innere Zuversicht zu finden. Pflegende können nur begleiten, wenn sie selbst diese Auseinandersetzung führen und Mitgefühl entwickeln.
Die Aufklärung und das Vertrauen in den eigenen Verstand spielen in Ihrem Buch eine große Rolle. Wie kann Selbstdenken helfen, Leid anders zu verstehen oder zu tragen?
Wir möchten Helfende unterstützen, sich ihrem Gegenüber bewusst und empathisch zu nähern. Eine hilfreiche Haltung entwickelt sich, wenn man sich mit dem eigenen Leben und dessen Endlichkeit auseinandersetzt. So kann man Vorurteile ablegen und dem Anderen unvoreingenommen begegnen.
Was können Fachkräfte tun, um Leid nicht nur zu behandeln, sondern wirklich zu verstehen?
In „Behandeln“ steckt „Handeln“ – das Objekt ist passiv. Unser Ansatz kehrt das um: Der Leidende ist das handelnde Subjekt, das mit seinen Erfahrungen, Lebensleistungen und Persönlichkeitsfacetten wahrgenommen werden will. Nur so können Wünsche, Bedürfnisse, Ängste und Stimmungen verstanden werden. Es braucht keine langen Interviews – aber echtes Interesse, Fragen nach dem augenblicklichen Erleben und nach dem, was diesem Menschen wichtig ist. Es geht um Würde und menschliche Hinwendung.
Sie betonen die Bedeutung der inneren Haltung. Wie kann man eine Haltung entwickeln, die empathisch und zugleich schützend ist?
Wer einen medizinischen, pflegerischen oder hospizlichen Beruf wählt, tut dies meist aus humanitärer Motivation. Doch der Fokus verschiebt sich oft auf Organisation, Dokumentation und Effizienz. Es gilt, sich auf das Grundanliegen zu besinnen: Menschen helfen zu wollen, wie man es sich selbst wünschen würde. Dazu gehören respektvolle Ansprache, Verständnis für Sorgen, fachliche Sicherheit und Verlässlichkeit.
Die psychische Belastung ist hoch. Um nicht zu verzweifeln, gilt es, Mitgefühl zu zeigen, aber innerlich Abstand zu wahren: „Dies ist sein Schicksal, nicht meines.“ Diese Haltung, ergänzt um Teamunterstützung, Supervision und Psychohygiene, erhält die eigene seelische Gesundheit.
Sie schreiben, dass Hoffnung das Leid verändern kann. Was bedeutet „Hoffnung“ für Sie in einem palliativen Kontext?
Nimm niemandem die Hoffnung, belüge aber auch niemanden. Cicely Saunders empfahl: „Hoping for the best, preparing for the worst.“ Hoffnung begleitet Menschen in jeder Krankheitsphase: zuerst auf Heilung, dann auf Zeit, später auf ein beschwerdearmes Lebensende. Hoffnung gibt es immer – sie soll gestützt und gefördert werden.
Im Buch finden sich die sieben „Leid(t)fragen für den täglichen Gebrauch“. Wie können diese Fragen helfen?
Die 7 Leitfragen bilden die Essenz unserer Grundhaltung und dienen als innerer Leitfaden für jede Begegnung. Sie helfen, alle Aspekte einer würdevollen, individuellen und ressourcenorientierten Begleitung im Blick zu behalten.
Wenn Leserinnen und Leser nur einen Gedanken mitnehmen sollen – welcher wäre das?
Wir wollen Mut machen, vom Patienten her zu denken und seine Erlebenswelt zu verstehen. Wer dem leidenden Menschen vorbehaltlos und mit Mitgefühl begegnet, kann auch die eigene Hilflosigkeit verringern und die Arbeitszufriedenheit steigern.
über die AutorInnen:
PROF. DR. DR. ANDREAS S. LÜBBE
ist Onkologe und Palliativmediziner. Er war Chefarzt und Ärztlicher Direktor und lehrt jetzt an der Universität Hamburg sowie an der Palade Universität Targu Mures (Campus Hamburg). Er befasst sich mit medizinischen und ethischen Themen, die das Lebensende betreffen.
DIPL.-PSYCH. IRMELA LÜBBE
ist Krankenschwester, Psycholog. Psychotherapeutin, Psychoonkologin und Palliativpsychotherapeutin. Sie war in allen Sektoren onkologischer Versorgung sowie für palliativmedizinische Schulungen für Ärzte und Pflegende tätig.
Die Reihe der Mutbüchlein wurde von Prof. Dr. Andreas Heller (Universität Graz) begründet. Andreas Heller und Dr. Patrick Schuchter (Universität Graz) sind gemeinsam als Herausgeber der Reihe und Autoren des Band 1, „Sorgekunst“ verantwortlich.