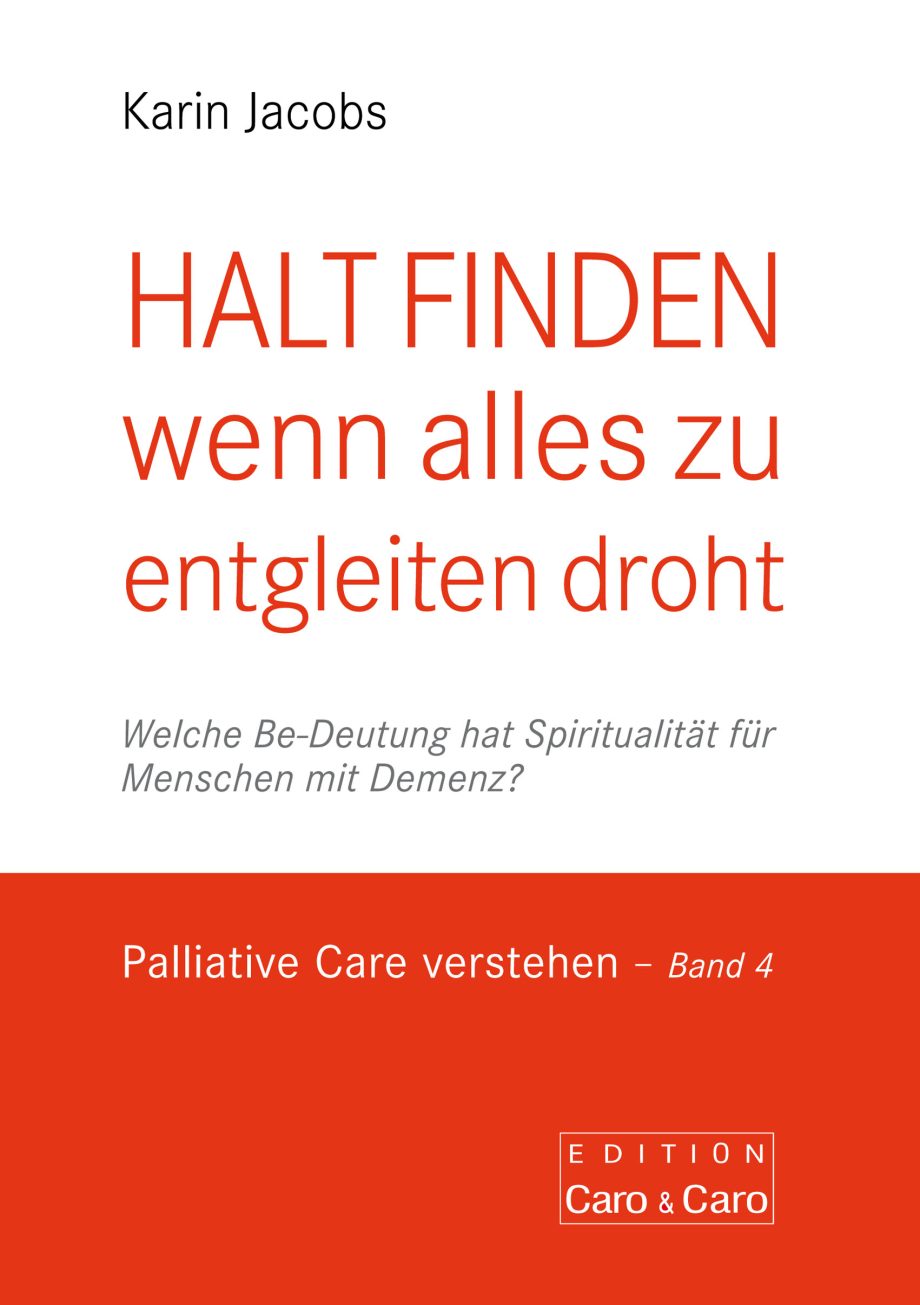Eine seelsorgerische Perspektive auf assistierten Suizid
Der assistierte Suizid ist ein komplexes Thema, das oft auf die Frage „Darf man oder darf man nicht?“ reduziert wird. Doch die kirchliche Haltung dazu ist differenzierter und stellt die menschliche Begleitung in den Vordergrund. Die Seelsorge möchte Schwerkranken in ihrer Not beistehen und ihnen nicht einfach die Entscheidung überlassen, allein aus dem Leben zu scheiden.
Diese Haltung wird maßgeblich von drei zentralen Konzepten beeinflusst:
1. Cicely Saunders und das Konzept des „Total Pain“
Die Pionierin der Hospizbewegung, Cicely Saunders, prägte den Begriff „Total Pain“. Er beschreibt, dass Schmerzen bei Sterbenden nicht nur körperlich sind, sondern auch psychische, soziale und spirituelle Ursachen haben können.
- Was es bedeutet: Wenn Menschen den Wunsch nach Suizid äußern, kann dieser Wunsch oft als Ruf nach Hilfe verstanden werden, um unerträgliche Zustände zu beenden – nicht zwingend das Leben selbst. Das Ziel der Palliativ- und Hospizversorgung ist es, all diese Schmerzebenen zu lindern und so die Lebensqualität bis zum Schluss zu verbessern.
- Kirchliche Haltung: Die Kirche nimmt diesen ganzheitlichen Ansatz auf und sieht ihre Aufgabe darin, den Schwerkranken dabei zu helfen, ihren Blick zu weiten und möglicherweise noch verbliebene „Kostbarkeiten“ im Leben zu finden. Sie bekräftigt, dass die Begleitung von Sterbenden nicht nur auf die Vitalität (messbares Dasein), sondern vor allem auf die Lebendigkeit (empfundenes Leben) zielt.
2. Viktor Frankl und der Sinn des Lebens
Der Psychotherapeut Viktor Frankl vertrat die Überzeugung, dass das Leben immer einen „unbedingten Sinn“ hat – unabhängig von den aktuellen Umständen und dem Leiden. Er hat in seiner Arbeit erfahren, dass Menschen, die einen Grund finden, weiterzuleben, auch extreme Situationen ertragen können.
- Was es bedeutet: Suizidale Gedanken entstehen oft, wenn das Leben als sinnlos empfunden wird. Frankl lehrt, dass wir die Situation vielleicht nicht ändern können, aber unsere Einstellung dazu. Es ist möglich, auch im Leiden Sinn zu finden und daran zu reifen.
- Kirchliche Haltung: Die Seelsorge orientiert sich an diesem Gedanken, indem sie Sterbende dabei unterstützt, nach verbliebenen Sinnspuren im eigenen Leben zu suchen. Sie möchte Menschen dabei helfen, nicht nur gut zu sterben, sondern bis zuletzt zu leben.
3. Reimer Gronemeyer und Andreas Heller zur „Sorgekultur“
Viele Sterbewünsche entstehen aus der Angst heraus, anderen zur Last zu fallen, oder aus dem Gefühl der Einsamkeit. Gronemeyer und Heller betonen die Notwendigkeit einer sogenannten „Sorgekultur“, die diesem Gefühl entgegenwirkt.
- Was es bedeutet: Menschliches Leben und Sterben ist nie nur eine Privatangelegenheit. Es braucht eine Gemeinschaft, ein Beziehungsnetz, das den Sterbenden auffängt und ihm das Gefühl gibt, nicht allein zu sein. Diese „Sorgekultur“ stellt die Zeit für menschliche Nähe über ökonomische Überlegungen.
- Kirchliche Haltung: Die Kirche betont, dass der oft angeführte Satz „Mein Tod gehört mir!“ zu kurz greift. Sie sieht sich in der Pflicht, einen schützenden Raum zu schaffen und Menschen in Not beizustehen. Die Begleitung auch von Menschen mit Suizidwunsch wird als Akt der „kritischen Solidarität“ verstanden: Die Kirche hinterfragt und lehnt den Suizid als moralische Handlung ab, ist aber gleichzeitig solidarisch mit dem leidenden Menschen und lässt ihn nicht allein.
Fazit: Seelsorge als „kritische Solidarität“
Die kirchliche Haltung zum assistierten Suizid lässt sich als eine Balance zwischen klarer ethischer Überzeugung und bedingungsloser seelsorgerischer Begleitung beschreiben. Auch wenn die Kirche den Suizid grundsätzlich ablehnt, so gilt für sie doch das augustinische Prinzip: „Ich will, dass du bist!“. Es bedeutet, jeden Menschen vorbehaltlos zu lieben und ihm in seinen schwersten Stunden beizustehen – selbst wenn seine Entscheidungen nicht gutgeheißen werden. Die seelsorgerische Begleitung soll in Extremsituationen Vorrang vor der moralischen Bewertung haben, um zu zeigen, dass Gottes unkündbare Treue zu jedem Menschen gilt.
Zum Weiterlesen:
KAMP kompakt, Ausgabe 10, Christlicher Beistand
„bis zuletzt“ Profilierte Seelsorge im Kontext von Spiritual Care und Suizidbegehren