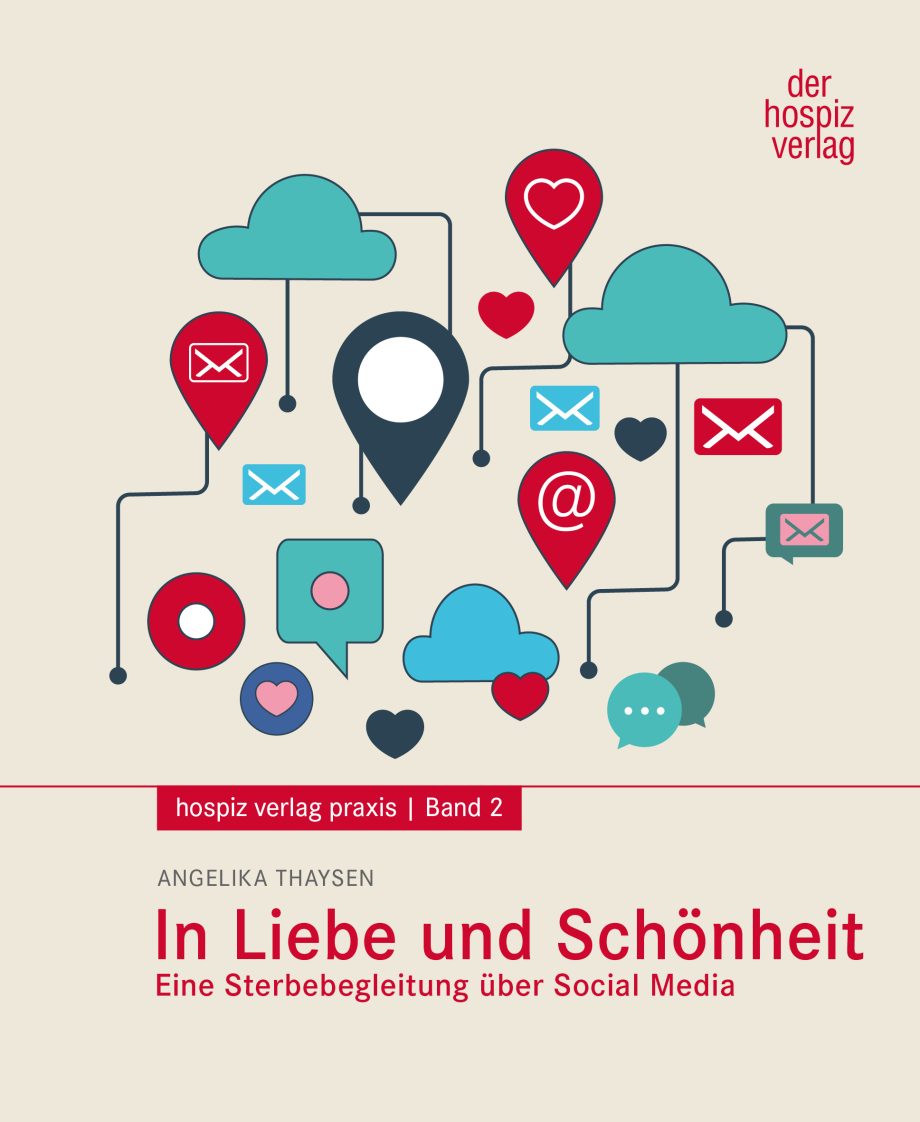Ein Tag der Hoffnung, Haltung und Sorge
Vor wenigen Tagen fand in Dresden der 11. Hospiz- und Palliativtag des Landesverbands Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V. statt – ein Fachtag, der eindrucksvoll zeigte, was es bedeutet, eine Kultur der Sorge zu leben. Rund 60 % der 350 teilnehmenden ZuhörerInnen engagieren sich ehrenamtlich – sie setzen damit ein starkes Zeichen für die gelebte Solidarität in der Hospizbewegung.
Paradigmenwechsel in der Palliativversorgung
Markus Seibt, Vorstandsvorsitzender des Landesverbands, eröffnete den Tag mit einem klaren Blick auf die Herausforderungen: Palliativversorgung betrifft längst nicht mehr nur onkologische Erkrankungen – es geht um alle Menschen mit unheilbaren Erkrankungen. Dabei bringt die Hospizarbeit Ressourcen ein, die in der Regelversorgung oft fehlen – insbesondere die Zeit, die Zuwendung und das Engagement der Ehrenamtlichen.
Hoffnungsvoll durch Sorge – Ethikvortrag mit Tiefgang
Einen Höhepunkt bildete der Festvortrag von Prof. Dr. Giovanni Maio, Medizinethiker aus Freiburg. In wegweisenden Worten machte er deutlich: Hoffnung ist nicht Naivität, sondern eine innere Haltung, die auch das Schwierige nicht ausblendet.
„Der Hoffende beschönigt nicht – er hält aus, sieht das Rettende und bleibt offen für das, was möglich ist.“
Prof. Maio beschrieb die Sorgekultur als Haltung der Zugewandtheit und Aufmerksamkeit – nicht als abrechenbare Leistung, sondern als menschlichen Beistand. Sorge bedeutet: Ich sehe dich. Ich bleibe. Ich glaube an deine unverlierbare Würde, auch wenn das Leben sich dem Ende zuneigt.
Sorge braucht Begegnung, Beziehung und Gemeinschaft
In einer Sorgekultur geschieht Begleitung nicht durch Aktivismus, sondern durch echtes Interesse am Gegenüber. Die Begegnung auf Augenhöhe, das aufrichtige Zuhören, die Bereitschaft, mit der Einsamkeit des anderen in Kontakt zu treten – das alles sind zentrale Elemente.
Sorge kann nicht dokumentiert werden – sie wird erlebt.
Sorge ist dabei keine Einzelanstrengung, sondern entsteht in Gemeinschaft. Hospizarbeit heißt, gemeinsam Sinn zu stiften – auch und gerade am Ende des Lebens.
Sorge sichtbar machen – Einsamkeit begegnen mit Haltung und Beziehung
Im Anschluss an Prof. Maios Festvortrag zur ethischen Theorie einer Sorgekultur schlug PD Dr. Elisabeth Jentschke, Psychogerontologin und Palliativpsychologin aus Würzburg, den Bogen von der ethischen Theorie in die berufliche Praxis der Sorgekultur. Ihr Thema: „Einsamkeit in der letzten Lebensphase“ – ein Phänomen, das viele schwer kranke Menschen betrifft und tief mit der Frage verbunden ist, wie wir Würde und Hoffnung am Lebensende bewahren können.
Dr. Jentschke knüpfte bewusst an die Grundgedanken von Prof. Maio an: Echte Sorge beginnt dort, wo wir aufhören zu handeln und anfangen zu begegnen. Sie betonte, dass man Einsamkeit nicht mit Aktivismus auflösen kann, sondern durch Präsenz, Verlässlichkeit und das Teilen von Stille.
„Im Sinne von Maio heißt Sorge: Ich lasse mich ansprechen, ich nehme wahr, ich bleibe.“
Einsamkeit verstehen – Beziehungsarbeit fördern
Einsamkeit sei ein subjektives Gefühl, das entsteht, wenn soziale Bedürfnisse nicht erfüllt werden – und nicht mit äußerlichem Alleinsein zu verwechseln. Dr. Jentschke zeigte eindrücklich, wie belastend Einsamkeit für die psychische und physische Gesundheit sein kann. Sie gilt als Risikofaktor für Depression, Hoffnungslosigkeit und sogar Todeswünsche.
Was hilft gegen Einsamkeit? Die Referentin zeigte praxisnahe Wege auf, wie eine Sorgekultur konkret gelebt werden kann:
- Zeit geben & Dasein – präsent sein, ohne etwas „leisten“ zu müssen
- Verlässliche Beziehung aufbauen – kleine Gesten, wiederkehrende Rituale
- Biografisches Wissen einbeziehen – Identität erkennen und würdigen
- Patientenzentrierte Gesprächsführung – zuhören, ohne sofort zu reagieren
- Spiritualität Raum geben – als Quelle von Hoffnung, wie sie auch Prof. Maio beschreibt
Sie verwies dabei auf die Würdezentrierte Therapie nach Chochinov als praktikablen Ansatz für den Hospizalltag – mit Fragen wie: Was soll bleiben? Was gibt Ihrem Leben Bedeutung? Diese biografiebezogene Haltung macht aus Fürsorge echte Mit-Menschlichkeit.
Haltung statt Hektik – Achtsamkeit statt Aktionismus
Dr. Jentschkes Vortrag war eine eindrucksvolle Einladung, die Haltung hinter dem Tun zu reflektieren. Viele Pflegekräfte kennen das Gefühl, keine Zeit zu haben, emotional belastet zu sein oder bei manchen Menschen „nicht durchzudringen“. Doch Einsamkeit darf nicht zur Gewohnheit erklärt werden.
„Der erste Schritt ist, da zu sein. Mit der Bereitschaft, auch nichts tun zu müssen – außer zu bleiben.“
Damit wurde deutlich: Eine Kultur der Sorge lässt sich nicht verordnen, aber gestalten – durch bewusste Kommunikation, empathisches Zuhören und die Bereitschaft, Beziehung zu wagen.
Was bleibt?
Der Fachtag machte eindrucksvoll deutlich: Hospizarbeit heißt Hoffnung stiften. Nicht durch Worte allein, sondern durch Haltung, durch Beziehung, durch das Teilen von Zeit und Mitgefühl.
Eine würdevolle Sorgekultur ist ein Auftrag an uns alle – beruflich wie ehrenamtlich, persönlich wie gesellschaftlich.
Merken Sie sich den nächsten Termin vor!
Der nächste Sächsische Hospiz- und Palliativtag findet 2027 statt. Schon jetzt ist klar: Auch der 12. Fachtag wird wieder Impulse setzen – für eine menschliche, würdevolle und hoffnungsvolle Begleitung am Lebensende.