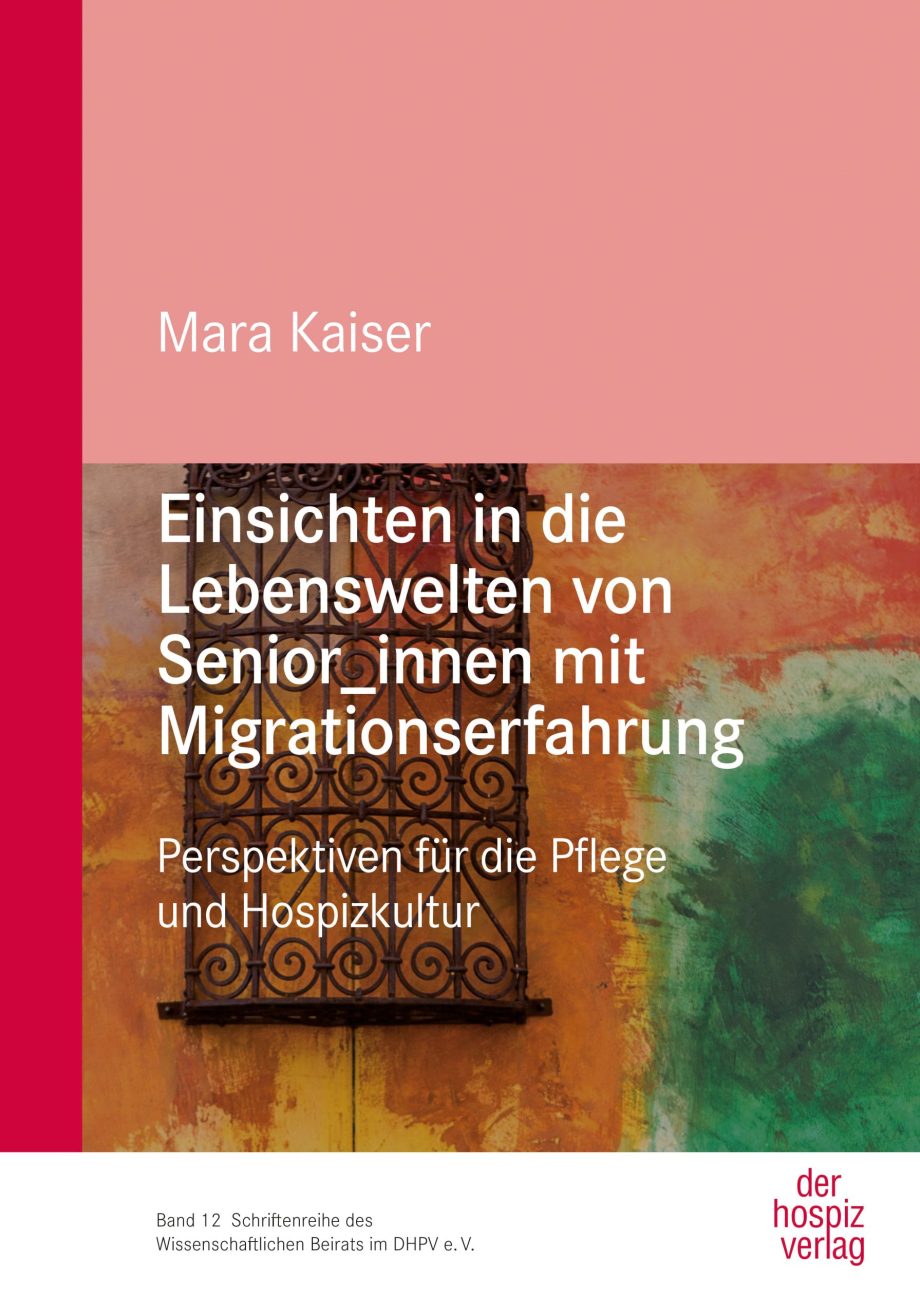Muslimische Seelsorge im Hospiz: Ein wichtiger Beitrag
Bekannterweise geht es in der Palliativversorgung darum, Menschen am Lebensende ganzheitlich zu begleiten. Dazu gehören auch ihre spirituellen und religiösen Bedürfnisse. In unserer pluralistischen Gesellschaft ist das eine besondere Herausforderung. Ein aktuelles Essay von Frau Dilek Uçak-Ekinci beleuchtet die wichtige Rolle der muslimischen Seelsorge in diesem Kontext und zeigt, wie sie die Arbeit in Hospizen bereichern kann.
Warum ist muslimische Seelsorge so wichtig?
Der Artikel von Dilek Uçak-Ekinci verdeutlicht, dass die spirituellen Bedürfnisse von Patient:innen mit muslimischem Hintergrund oft unzureichend verstanden werden. Das kann zu Spannungen und Missverständnissen führen, besonders wenn unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen – sei es bezüglich der Weitergabe von Diagnosen, der familiären Entscheidungsfindung oder dem Vertrauen in das Gesundheitssystem.
Einsichten in die Lebenswelten von Senior_innen mit Migrationserfahrung
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Hier kommt die muslimische Seelsorge ins Spiel. Sie ist mehr als nur eine „kulturelle Vermittlung“. Sie schafft einen geschützten Raum, in dem Patient:innen und ihre Familien ihre Hoffnungen, Ängste und religiösen Überzeugungen frei ausdrücken können, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Seelsorger:innen mit muslimischem Hintergrund kennen sowohl die institutionellen Abläufe als auch die familiären und religiösen Traditionen. Sie können als Brücke wirken, die Kommunikation verbessert und so zu einer wirklich patientenzentrierten Versorgung beiträgt.
Hoffnung und Akzeptanz sind kein Widerspruch
Ein zentraler Punkt des Berichts ist das Zusammenspiel von Hoffnung und Akzeptanz. In der muslimischen Spiritualität sind diese beiden Haltungen keine Gegensätze, sondern können gleichzeitig existieren.
Der Bericht beschreibt diese Dynamik anhand einer Fallvignette:
„Wir müssen ehrlich sein – es gibt keine Hoffnung mehr“, sagt der Oberarzt ruhig und offen beim gemeinsamen Gespräch mit dem ärztlichen Team, den drei erwachsenen Kindern der Familie und einer Pflegefachperson. Der Patient, Herr M., 68 Jahre alt, liegt mit einem fortgeschrittenen Pankreaskarzinom auf der Palliativstation. Die medizinische Lage ist eindeutig.
Einen Moment lang ist es still. Dann antwortet der älteste Sohn bestimmt: „Das ist Allahs Entscheidung.“ Die Atmosphäre spannt sich spürbar.
Nach dem Gespräch bittet die Pflegefachperson – wahrnehmend, wie angespannt und sprachlos die Situation geworden ist – die muslimische Seelsorgerin auf die Station, um die Familie zu begleiten. Im Flur begegnet diese der erschöpft wirkenden Tochter. Sie kommen rasch ins Gespräch. „Wir wissen, dass unser Vater stirbt. Wir müssen das nicht jeden Tag aufs Neue hören.“ (Fallvignette basierend auf einer anonymisierten Schilderung aus der seelsorglichen Praxis, 2024).
In dieser Situation wird deutlich, dass Hoffnung auf Gottes heilende Macht und die Akzeptanz seines Willens, sollte der Tod eintreten, nicht im Widerspruch zueinander stehen. Sie bilden eine spirituell tief verankerte Doppelbewegung. Ausdrücke wie „Das ist Allahs Entscheidung“ oder „Allah ist der Heilende“ bedeuten nicht zwangsläufig, dass eine Diagnose geleugnet wird. Sie sind vielmehr ein Zeichen von Vertrauen und der Einbettung der Situation in einen göttlichen Plan.
Das Verständnis dieser spirituellen Haltung ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden. Muslimische Seelsorge hilft dabei, diese tieferen Bedeutungen zu erkennen und zu respektieren, und sorgt dafür, dass religiöse Haltungen nicht als Resignation oder Leugnung fehlinterpretiert werden.
Was wir mitnehmen können
Muslimische Seelsorge ist eine unverzichtbare Ressource. Sie kann:
- Verständigungsräume schaffen: Seelsorger:innen können in Familiengesprächen und Fallbesprechungen vermitteln und dazu beitragen, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten gehört und verstanden werden.
- Vertrauen fördern: Viele ältere muslimische Patient:innen haben negative Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem gemacht. Die Einbeziehung muslimischer Seelsorge kann helfen, Vertrauen aufzubauen und Stereotypen zu überwinden.
- Patientenautonomie neu verstehen: Während in westlichen Kulturen die individuelle Autonomie im Vordergrund steht, werden Entscheidungen in vielen muslimischen Familien gemeinschaftlich getroffen. Seelsorger:innen können diese Dynamiken erklären und begleiten.
Der Bericht fordert eine tiefere theologische und institutionelle Verankerung der muslimischen Seelsorge in der Praxis. Es ist anzunehmen, dass dies auch die Chance birgt, die Qualität der palliativen Versorgung weiter zu verbessern und die Vielfalt der uns anvertrauten Menschen noch besser zu berücksichtigen.
Zum Weiterlesen
Hier geht es zum originalen Essay vonFrau Dilek Uçak-Ekinci https://shorturl.at/rTvya
Online erschienen: 2025-08-12, © 2025 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston. Das Essay ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.