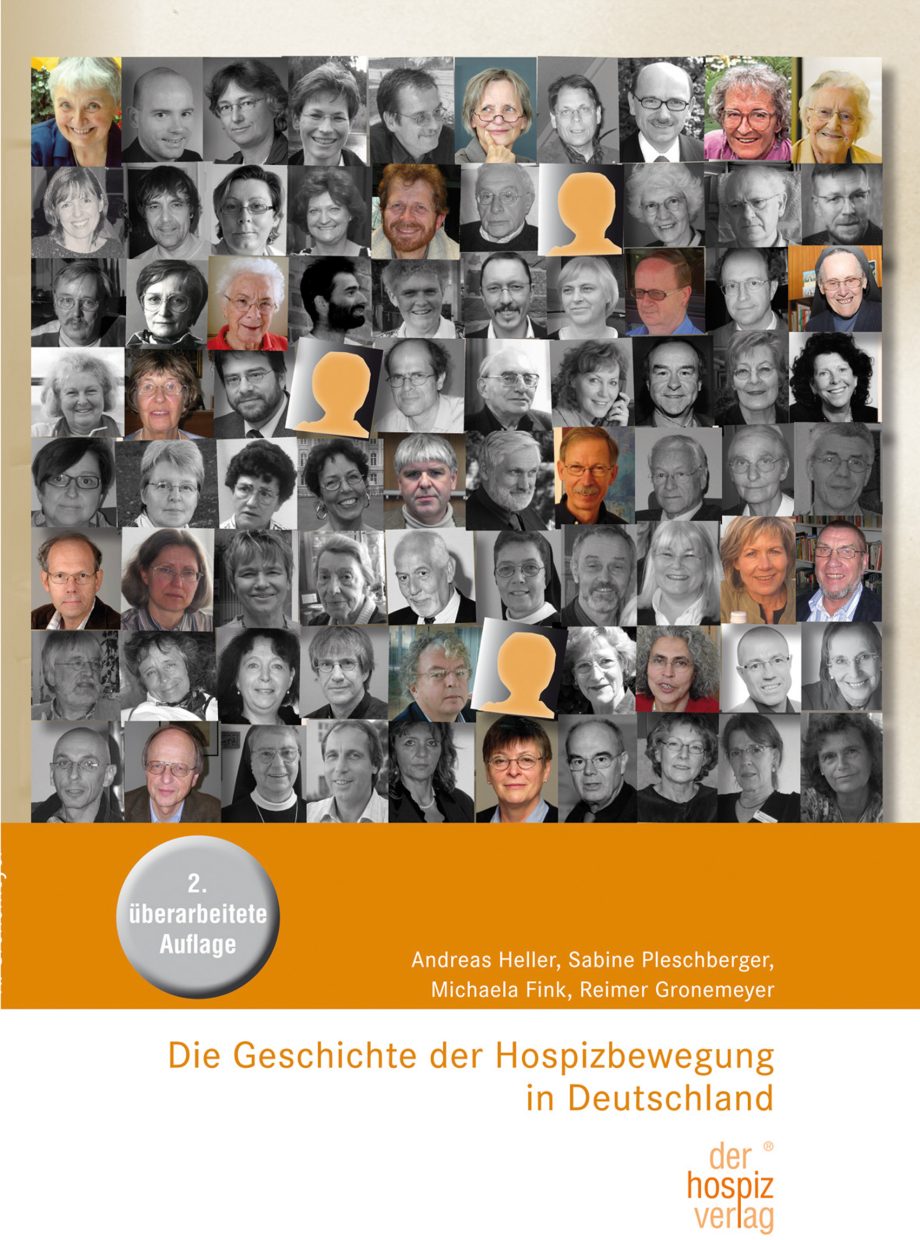Ein fragwürdiges Interview und seine Folgen
Nach dem assistierten Suizid des Wiener Lehrers, Autors und Journalisten Niki Glattauer am 4. September 2025, kritisieren Theologen, Ethiker und Palliativ-Expertinnen den medialen Umgang mit dem Thema.
Zwei Tage vor seinem Tod durch assistierten Suizid hatte Glattauer, unheilbar an Krebs erkrankt, in der Wochenzeitung „Falter“ und im Digitalmedium „Newsflix“ ein ausführliches Interview zu seiner Entscheidung gegeben. Nach eigner Aussage wollte er damit zur Enttabuisierung des assistierten Suizids beitragen.
Dabei waren Zeitpunkt und Form der Veröffentlichung laut beiden Redaktionen sein ausdrücklicher Wunsch gewesen. Der Zeitpunkt des Erscheinens erinnerte manchen „unangenehm an die Logik von Reality-Formaten“, die „allzu gut die voyeuristischen Bedürfnisse des Publikums befriedigt“.
Bedenken an der Botschaft des Interviews äußerte gegenüber der Katholischen Presseagentur Österreich beispielsweise die Grazer Palliativmedizinerin Desirée Amschl-Strablegg. Glattauers Worte hätten den Eindruck vermittelt, „dass da ein sehr einsamer, sehr verzweifelter Mensch spricht“. Problematisch sei auch der Titel „Ich will in Würde sterben“. Das impliziere, „dass alle, die den Weg anders zu Ende gehen, nicht in Würde sterben“. Aus ihrer Erfahrung in der Hospiz und Palliativversorgung wisse sie: „Man kann Menschen durch dieses finstere Tal begleiten. Oft kommen dabei Dinge zur Sprache, die vorher kein Thema waren – und das Leben bekommt angesichts des Todes eine neue, andere Qualität.“
Die Bioethikerin Susanne Kummer, Direktorin des Instituts für Medizinische Anthropologie und Bioethik (IMABE) sagte: „In welchem Land auch immer assistierter Suizid legalisiert wurde, sei dieselbe Entwicklung zu beobachten. Die Zahlen werden nicht weniger. Sie steigen.“
So zeigten Daten aus der Schweiz, dass Suizidassistenz andere gewaltsame Suizidformen nicht seltener gemacht, sondern die Gesamtzahl der Selbsttötungen erhöht habe. Auch seien zwischen 2010 und 2023 die assistierten Suizide von Schweizer Staatsbürgern um 385 Prozent – von 356 auf 1.729 Fälle gestiegen, während die Zahl „konventioneller“ Suizide konstant bei etwa 1.000 jährlich geblieben sei.
Mittlerweile weise die Schweiz mit insgesamt rund 2.700 Suiziden pro Jahr eine doppelt so hohe Rate wie Österreich bei vergleichbarer Bevölkerungsgröße auf – wobei aber auch in Österreich die Zahl assistierter Suizide seit Einführung des Sterbeverfügungsgesetzes 2022 deutlich gestiegen sind. Kummer berichtet: „2023 waren es noch 98 assistierte Suizide.“ Laut dem Sozialministerium wurden seit Inkrafttreten des Gesetzes (Stand 1. September 2025) österreichweit 772 Sterbeverfügungen errichtet und von Apotheken 636 letale Präparate abgegeben, wovon 99 Präparate retourniert wurden. Es ist demnach mindestens von einer Verfünffachung assistierter Suizide seit 2022 in Österreich auszugehen.
Die häufigsten Gründe für den Wunsch nach assistiertem Suizid seien Angst vor Abhängigkeit und Verlust an Würde, Schmerzen hingegen rangierten erst an vierter Stelle, verwies Susanne Kummer auf eine erst in diesem Jahr veröffentlichte Studie.
Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser betonte denn auch Zurückhaltung gegenüber der Suizidassistenz. Deren Legalisierung in Österreich sei keinen Anlass, diese als zusätzliche Option im Portfolio konfessionell betriebener Einrichtungen zu etablieren. Der Weg der Diakonie sei der hospizliche und palliative, „der assistierte Suizid ist kein Angebot, das es zusätzlich auch noch gibt“. Einzelfälle könne es bei Diakonie-Einrichtungen schon geben, deren Normalisierung sei jedoch klar abzulehnen, da diese Praxis „nie die beste Lösung“ sein könne. Man könne über das Leben letztlich nicht verfügen, „wir haben den Tod nicht in der Hand“, auch wenn die „Idealisierung des Suizids“ – auch in seiner assistierten Form – diese Tatsache zu verdrängen versuche.
Gegen die Forderung von Sterbehilfe-Vereinen, ein „entspannteres Verhältnis zum Tod“ zu entwickeln, sei nichts einzuwenden, bemerkt abschließend die IMABE-Direktorin Susanne Kummer. Dies sei aber „nicht dasselbe wie ein entspannteres Verhältnis zum Töten“, welches verhängnisvoll wäre.
Zum Weiterlesen: