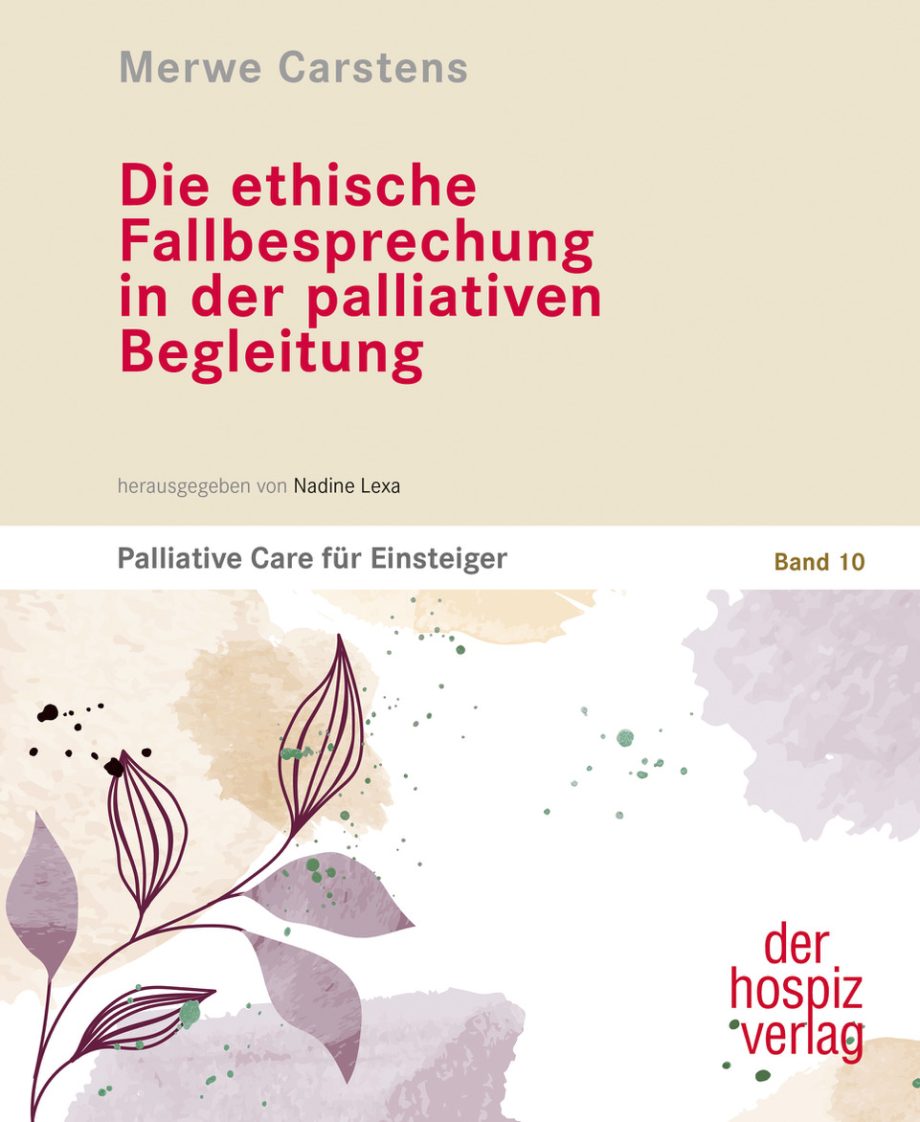Neue Einblicke in die Praxis der Suizidassistenz in der deutschen Palliativversorgung
Eine kürzlich durchgeführte Studie unter Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) hat wichtige Erkenntnisse zum Umgang mit Suizidassistenz in Deutschland geliefert. Seit dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im Februar 2020, das das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für verfassungswidrig erklärte, steigt die Aufmerksamkeit für dieses Thema. Allerdings gibt es bisher keine gesetzliche Neuregelung, was die Praxis der Suizidassistenz weiterhin schwierig macht.
Die Umfrage zeigt, dass etwa 60 % der befragten Fachkräfte seit 2020 konkrete Anfragen nach Suizidassistenz erhalten haben. Nur rund 7 % gaben an, seitdem auch tatsächlich Suizidassistenz durchgeführt zu haben. Die überwiegende Mehrheit der Anfragen betrifft hochbetagte Menschen (über 60 %), die meist an Krebs, neurologischen oder kardiovaskulären Erkrankungen leiden. Besonders häufig sind Autonomieverlust und Würdeverlust die Beweggründe für den Wunsch nach selbstbestimmtem Sterben. Viele der Betroffenen äußerten ihren Wunsch nach Suizidassistenz kurz vor oder während einer schweren Erkrankung.
Bei der Einschätzung der Freiverantwortlichkeit – also ob die Entscheidung für einen Suizid frei und verantwortungsvoll getroffen wurde – sind sich die Fachkräfte in 87 % der Fälle sicher. Dennoch ist nur etwa die Hälfte der Anfragen strukturiert hinsichtlich ihrer Wünsche erfasst worden. In rund 75 % der Fälle wurde vor der Durchführung eine zusätzliche Fachkraft eingeschaltet, meist ein Palliativmediziner, um die Voraussetzungen einer freiverantwortlichen Entscheidung zu prüfen. In einigen Fällen wurde auch direkt Suizidassistenz geleistet, vor allem durch das Verabreichen von Opioiden in Kombination mit Beruhigungsmitteln, wobei diese praktischen Verfahren stark variieren.
Ein zentrales Ergebnis betrifft die Gründe für die Suizidwünsche: Neben dem Verlust der Kontrolle über körperliche Funktionen und der Angst vor Schmerzen geben viele Betroffene auch den Verlust ihrer Lebensqualität, Überforderung sowie soziale Isolation an. Interessant ist, dass in manchen Fällen auch Angst vor zukünftigen Schmerzen oder dem Krankheitsverlauf eine Rolle spielt.
Die Studie betont die Notwendigkeit, die Professionalisierung im Umgang mit Suizidassistenz weiter auszubauen. Dazu gehören Schulungen im reflektierten Umgang mit Suizidwünschen, die Entwicklung klarer Richtlinien sowie die Einrichtung eines Registers, um Fälle systematisch zu erfassen und Standards zu verbessern.
Fazit: Die Ergebnisse zeigen, dass die Praxis der Suizidassistenz in der deutschen Palliativversorgung wächst, jedoch weiterhin mit Unsicherheiten verbunden ist. Es besteht großer Handlungsbedarf bei der Entwicklung einheitlicher Standards, um die Autonomie der Patienten zu schützen und die Entscheidungen professionell und ethisch fundiert zu begleiten.
Quellen:
– Bundesverfassungsgericht (2020). Urteil vom 26.02.2020, Az. 2 BvR 2347/15.
– Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP). Studie „Anfragen zu und Praxis von Suizidassistenz“. 2024.