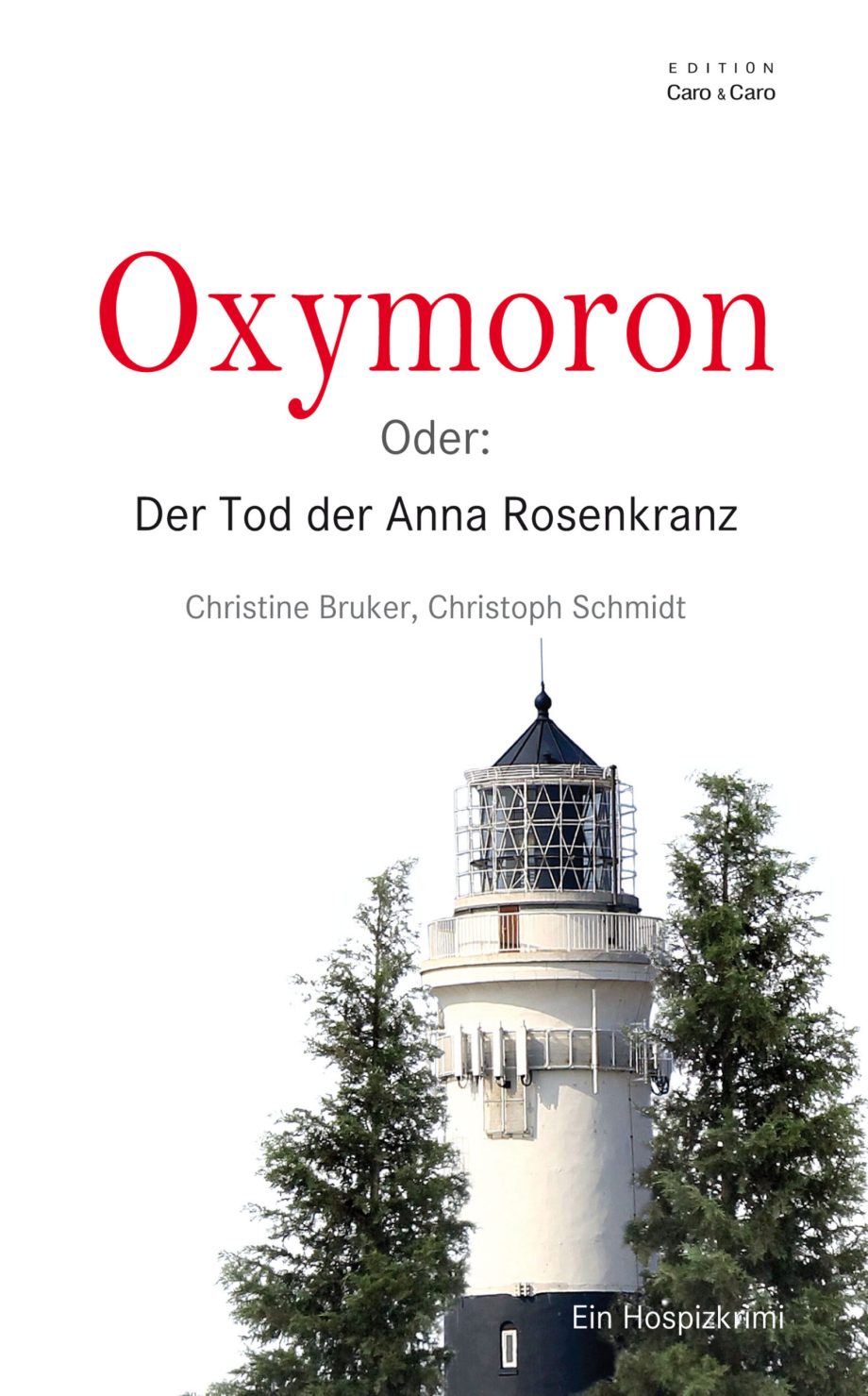Suizidprävention als gemeinsame Aufgabe – Fachbeirat in Niedersachsen veröffentlicht Stellungnahme
Der Bundesgesetzgeber arbeitet derzeit an einem neuen Gesetz zur Stärkung der Suizidprävention in Deutschland. In diesem Zusammenhang hat der Fachbeirat des Landesstützpunktes Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e. V. (LSHPN) eine Stellungnahme veröffentlicht, die die Perspektive schwerkranker und sterbender Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Der Fachbeirat – ein interdisziplinäres Gremium aus Wissenschaft und Versorgungspraxis – betont, dass Suizidprävention nicht allein eine politische oder medizinische Aufgabe sei. Vielmehr gehe es um eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die Mitmenschlichkeit, fachliche Kompetenz und Offenheit im Umgang mit Lebens- und Todesfragen erfordert.
Die Stellungnahme formuliert sechs zentrale Handlungsfelder, mit denen die hospizliche und palliative Praxis einen Beitrag zur Suizidprävention leisten kann:
- Fachlich kompetente Beratung und Behandlung:
Menschen mit schwerer Erkrankung brauchen Zugang zu einer qualifizierten, auf ihre Situation abgestimmten Versorgung. Ein gutes Verständnis von Linderungsmöglichkeiten – etwa bei Schmerzen oder psychischer Belastung – kann dazu beitragen, Suizidgedanken vorzubeugen. - Gesprächsangebote über Behandlung und Begleitung:
Betroffenen sollen Gespräche über alle Möglichkeiten hospizlicher und palliativer Behandlung offenstehen – auch in der häuslichen Umgebung. Solche Gespräche müssen frühzeitig angeboten und verlässlich begleitet werden. - Vertrauen in menschliche Nähe und Begleitung:
Schwerkranke Menschen sollen sich auf eine empathische, kontinuierliche Begleitung verlassen können – auch in spiritueller Hinsicht. Eine tragfähige Beziehung zu den begleitenden Fachpersonen kann Schutz und Halt bieten. - Bewertungsfreie Gesprächsräume:
Viele Menschen setzen sich am Lebensende wiederholt mit Fragen zum Tod auseinander – einschließlich des Wunsches, selbst über den Zeitpunkt des Sterbens zu bestimmen. Daher braucht es geschützte, urteilsfreie Räume, in denen solche Gedanken ausgesprochen und verstanden werden dürfen. - Fachliche Qualifizierung und Unterstützung der Begleitenden:
Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Seelsorgende, Psychologinnen, Sozialarbeitende und Ehrenamtliche benötigen Fort- und Weiterbildungsangebote, um Gespräche über Lebensende, Suizidgedanken oder Todeswünsche sicher und sensibel führen zu können. Auch Supervision, Ethikzirkel und kollegiale Beratung sind dafür notwendig. - Offene Kommunikation in der Gesellschaft:
Die Auseinandersetzung mit Todeswünschen stellt eine große Herausforderung dar – und zugleich eine Chance, den Blick auf eine würdige letzte Lebensphase zu lenken. Der Fachbeirat plädiert für eine ehrliche und transparente öffentliche Diskussion über die Gestaltung des Sterbens und die Bedeutung menschlicher Nähe in dieser Zeit.
Mit dieser Stellungnahme möchte der LSHPN einen fachlich fundierten und menschlich sensiblen Beitrag zur laufenden politischen und gesellschaftlichen Debatte leisten. Sie lädt dazu ein, sich mit den Perspektiven der hospizlichen und palliativen Praxis auseinanderzusetzen – und die bestehenden Versorgungsstrukturen so zu gestalten, dass niemand in einer Krise allein bleibt.
Der Fachbeirat versteht sich als Forum für Vernetzung, Austausch und fachliche Diskussion im Bereich der Hospiz- und Palliativarbeit. Seine Empfehlungen spiegeln die Expertise und Erfahrungen der Mitglieder wider, auch wenn sie nicht zwingend die Haltung der vertretenen Verbände wiedergeben.
Zum weiterlesen:
Die vollständige Stellungnahme kann auf der Website des Landesstützpunktes Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen e. V. eingesehen werden. https://shorturl.at/pejSS